Sind Sehen und Hören in der Oper „kompatibel“?
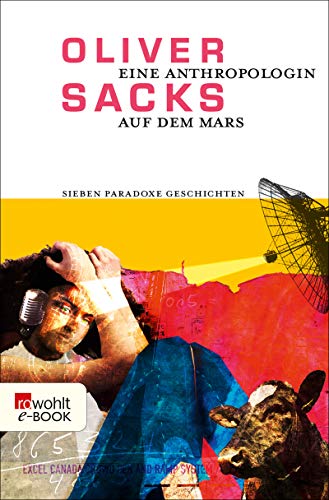
In seinem Buch Eine Anthropologin auf dem Mars beschreibt der New Yorker Neurologe und Schriftsteller Oliver Sacks den Fall eines jungen Mannes, der durch einen Hirntumor erblindet ist und sein Kurzzeitgedächtnis verloren hat. Beides ist ihm nicht bewusst.
„Als ich ihn auf das Sehen ansprach, räumte er zwar ein, dass seine Augen ‚nicht sonderlich gut‘ seien, fügte aber hinzu, dass er gern ‚fernsehe‘. Fernsehen hieß für ihn, wie ich später herausfand, aufmerksam den Stimmen oder den Geräuschen einer Show zu folgen und dazu passende Vorstellungsbilder zu erfinden. … Er war überzeugt davon, dass ‚Sehen‘ genau dies bedeutete, dass ‚Fernsehen‘ genau in dem bestand, was er tat, und dass es auch alle anderen Menschen so machten.“
Ein extremes Beispiel dafür, wieweit ein Sinnesorgan den Verlust eines anderen kompensieren kann. Wer nach einer Augenoperationen mehrere Tage mit verbundenen Augen zugebracht hat, wird dieses Phänomen nachvollziehen können: er konnte zwar nicht mehr sehen, wer gerade zu ihm ins Zimmer kam, hatte aber schnell gelernt, anhand der Schritte zu unterscheiden, ob es die Schwester, der Oberarzt oder ein Besucher war. Und er wird auch sonst wesentlich differenzierter gehört haben als im normalen Alltag. Leider scheint sich diese Sensibilisierung des Gehörs wieder zurückzubilden, sobald der Patient sehen kann. Dann bestätigt das Gehör lediglich, was zu sehen ist, ist somit im Alltag nur noch von untergeordneter Bedeutung.
Der Traum von der unsichtbaren Bühne
Wahrscheinlich war es das, was Richard Wagner meinte, als er sagte, dass er nach dem unsichtbaren Orchester in Bayreuth als nächstes die unsichtbare Bühne schaffen müsste. Konzertante Aufführungen oder Dunkelkammer-Inszenierungen a la Karajan wird damit schwerlich gemeint haben; vielleicht aber hatte er eine Art Vision von dem, was wir heute „Tonträger“ nennen. Spätestens zu Beginn der 50er Jahre, mit der Produktion der ersten Gesamtaufnahmen auf Langspielplatten, schien sich der Traum von der „unsichtbaren“ Bühne zumindest teilweise erfüllt zu haben. Selbst Wilhelm Furtwängler, der dem Medium Schallplatte bis dato eher skeptisch gegenüberstand, musste gegenüber dem Plattenproduzenten Walter Legge zugeben: „Als ich die ‚Tristan‚-Platten schließlich im ganzen abhörte, war ich vor allem erstaunt über die Wirkung des Wagnerschen Werkes. Hier, wo die ganze Problematik der Bühne wegfällt, kommt es einem erst ganz zu Bewusstsein, wie großartig der musikalische Zusammenhang und die nie erlahmende Inspiration in diesem einzigartigen Werke ist.“
Selbstverständlich blieb für Furtwängler das hauptsächliche Manko der Platte nach wie vor bestehen: Das fehlende Gemeinschaftserlebnis. Schon in den 50er Jahren war das Platten- und Radio-Hören eine zunehmend einsame Sache geworden. Die Zeit der Großfamilie ging allmählich zu Ende – und damit auch das gemeinsame Hören von Radio-Sendungen und Platten.
Wer nicht hören will, muss sehen
Ich hatte das Glück, meine ersten wichtigen Platten meist mit Vater, Mutter, Onkel oder Tante zu hören. Außerdem gab es in den 70er Jahren noch Verkäufer, der sich die Mühe machten, ihren Kunden in der Hör-Kabine die besten Stellen einer Aufnahme vorzuspielen. Auf diese Weise entdeckte ich Vieles, das ich sonst wahrscheinlich ignoriert hätte, z. B. La Gioconda mit Renata Tebaldi (als Callas-Fan war ich eine Zeitlang einseitig orientiert). Später hörte ich mit einem Schulfreund stundenlang Mahler-Sinfonien in allen verfügbaren Aufnahmen von Mitropoulos bis Bernstein.
Heute ist Platten-Hören in den meisten Fällen eine solistische Tätigkeit. Man trifft sich zum Essen, geht zusammen ins Kino, ins Konzert und in die Oper. Oder trifft sich zu Hause zum Video-Abend. Aber wer, von einigen Melomanen abgesehen, trifft sich schon zum gemeinsamen Hören? Selbst bei Berufs-Hörern passiert es äußerst selten – in einem Redaktionsteam höchstens nach leidenschaftlichen Streitgesprächen über eine CD oder DVD.
Wird auf Hörerfahrung und –bildung in unserer Profession überhaupt noch Wert gelegt? Ein Großteil der Musikkritiken lässt daran zweifeln, vor allem solche über Neuproduktionen von Opern: Drei Spalten über die Inszenierung und zum Schluß ein paar pauschale Urteile zum musikalischen Teil. Haben selbst die Profis das Hören verlernt? Druck „von oben“, vom Ressortleiter und Verleger? Oder „von unten“, von der Leserschaft? Eines scheint klar: Wenn in einer Aufführung des Trovatore das Verhör der Azucena als Folter-Orgie mit Elektro-Schocks präsentiert wird, wird sich der Leser kaum noch für lange Ausführungen über Sänger, Orchester und Dirigent interessieren. Sich damit aufzuhalten, wäre in etwa so, als würde man nach der Kakerlaken-Szene in der Urwald-Show die Gesangstechnik von Daniel Küblböck beschreiben. Ob es uns gefällt oder nicht: Das Optische hat nicht nur bei RTL Vorrang, sondern auch im „seriösen“ Feuilleton, zumal wenn es „spektakulär“ ist und jedermanns Voyeurismus bedient. Außerdem wird kaum ein Journalist abstreiten, dass die Beschreibung einer sogenannten „Skandalinszenierung“ unendlich dankbarer (und somit handwerklich wesentlich einfacher) ist als eine detailliert-kritische Analyse der musikalischen Interpretation.
Träumte Wagner deshalb von der „unsichtbaren Bühne“? Ahnte er, dass das Veräußerlichte, Offen-Sichtliche den Zugang zum aktiven Hören – und damit zum musikalischen Erleben – versperren wird?
Hören lernen
Vielleicht ist kein Medium zur Sensibilisierung des Gehörs so geeignet wie die Platte. Man kann eine Phrase oft wiederholen, versuchen dem Geheimnis ihrer besonderen Wirkung auf die Spur zu kommen; man kann eine Szene in unendlich vielen Varianten vergleichen; man kann hören, wie Dietrich Fischer-Dieskau die Winterreise 1948, 1953, 1965 und 1982 gestaltete. Elisabeth Schwarzkopf erzählte mir, dass es zu ihrer Studentenzeit an der Berliner Hochschule einen Dozenten gab, der hauptsächlich mit Platten-Vergleichen arbeitete. „Seine Klasse war immer randvoll. Er hat uns die Sachen vorgespielt und gesagt: ‚Passt auf diesen Ton auf, wie er den vorbereitet, passt auf diese Phrase auf. Das andere ist nicht so wichtig; aber diese eine Stelle ist wichtig.‘ Und er hat uns nicht nur die besten Aufnahmen gespielt. Manchmal hat man gedacht: Naja, ich weiß eigentlich nicht, warum dieser Sänger so berühmt ist – und dann kam eine Phrase, wo es einem wie Schuppen von den Ohren fällt: Aha, deshalb! Auf diese Weise haben wir nicht nur unser Gehör entwickeln können, sondern auch unsere Vorstellungskraft.“
Eigentlich müssten solche Platten-Vergleiche zum Alltag jeder Musikschule und Hochschule gehören; de facto aber sind sie eher die Ausnahme als die Regel. In Gesprächen mit jungen Sängern und Dirigenten bin ich oft erschüttert, wie wenig sie sich für die Arbeit ihrer Vorgänger interessieren. Manche kennen noch nicht einmal Klassiker wie die Tosca unter Victor de Sabata oder den Rosenkavalier unter Erich Kleiber – und behaupten noch, sie bräuchten keine Platten, um ihre Vorstellungskraft zu entwickeln; es stünde ja alles in den Noten. Auch bei jungen Musikjournalisten trifft man teilweise auf einen eklatanten Mangel an Hör-Erfahrung. Darum lautete mein Vorschlag, als wir nach einem griffigen Arbeitstitel für die Robert-Schumann-Werkstatt für junge Musikkritiker suchten: „Hören und schreiben lernen“. Denn welchen Sinn hat es über Musik zu schreiben, wenn man das Hören nicht gelernt hat? Schreiben ist eher eine Sache der Begabung. Hören kann man lernen, so wie man eine Fremdsprache oder ein Instrument erlernt. Glücklicherweise geht es meist wesentlich schneller – das zeigen zumindest meine Erfahrungen mit den Teilnehmern der Kritiker-Werkstatt. Wer bereit ist, aktiv und konzentriert zuzuhören und seine Hör-Erfahrungen mit anderen auszutauschen, wird in relativ kurzer Zeit Stimmen großer Sänger genauso unterscheiden können wie die Gesichter berühmter Schauspieler. Und dann fängt der Spass eigentlich erst an: Aktives Hören kann so lustvoll sein, dass es ganz schnell zur Leidenschaft wird.
Leidenschaft und Fetisch
Die Extreme solcher Hör-Lust hat Wayne Koestenbaum in seinem Kult-Buch The Queen’s Throat (Königin der Nacht) immer wieder beschrieben: „Für mich war es Anna Moffos verzögerter, dämmriger, ein wenig unter dem korrekten Ton gesungener Angriff auf das Wort ‚disvelto‘ in einer Phrase in ‚Rigoletto‚ – wie sie das Wort nahm (das in sich weder bedeutend noch musikalisch wichtig ist) und es mit Individualität und Pathos auszeichnete. In anderen Aufführungen mit anderen Gildas ging dieses ‚disvelto‘ unbemerkt vorüber, wurde es nicht mit einer Betonung belohnt. Die Moffo hatte die Macht, eine Note, einen Ton von innen zu erwärmen – und ich hatte die Macht, lauschend auf diesen Moment zu warten.“
Wie jede Leidenschaft ist auch Platten-Hören eine ambivalente Sache: Es kann eine ganze Welt bedeuten, aber auch zum Fetisch werden. Theater-Macher weisen gern darauf hin, dass exzessives Platten-Hören den Genuss am Live-Erlebnis trüben kann. Dem wird man kaum widersprechen können; viele Theatergänger sind durch prägende Platten-Erlebnisse mehr oder minder „verdorben“. Koestenbaum ging es so mit der oben beschriebenen Phrase in Rigoletto, mir geht es so mit den letzten Takten im Finale des zweiten in Aida. Obwohl ich genau weiß, dass heute keine Sängerin so verrückt ist, warte ich insgeheim doch darauf, dass sie zum Schluß aufs dreigestrichene Es geht – wie Maria Callas 1951 in Mexico-City. Dieser berühmte Callas-Ton, der wie ein Flammenwerfer durch den Klangbrei von Chor und Orchester dringt, hat mich für jede Aufführung verdorben.
Das Auge hört mit
Aber es gibt mindestens so oft den umgekehrten Fall: Dass wir nach einer aufregenden Vorstellung jede Platten-Version als lauwarm empfinden. Besonders erhellend ist in diesem Kontext der Vergleich von Aufführung und Aufzeichnung: Da hat man in Bayreuth oder Salzburg eine hinreißende Aufführung erlebt – und ist total enttäuscht, wenn man den Mitschnitt derselben Vorstellung zwei Wochen später im Radio hört.
Das Auge hört immer mit. Dass manche fast nur mit den Augen hören, zeigt sich immer wieder bei Vorsingen und Wettbewerben. Und damit meine ich nicht in erster Linie die klassische Situation, dass sich im Zuschauerraum meist mittelalterliche bis ältere Herren und auf der Bühne junge attraktive Damen befinden. Sondern die tägliche Praxis des type casting. Hat sie die physique du role, passt sie in die Inszenierung, ist sie eine gute Darstellerin? Diese Kriterien spielen oft eine größere Rolle als stimmliche und musikalische Qualitäten.
Dass selbst Komponisten ihre eigenen Werke mehr mit den Augen als mit den Ohren hören, zeigt der Fall Maria Jeritza. Erst wenn man die Sängerin in einem Filmausschnitt sieht, wird man begreifen, warum Richard Strauss und Erich Wolfgang Korngold so fasziniert von ihr waren; ihre Aufnahmen (zumal die Live-Mitschnitte aus der Wiener Staatsoper) sind für detonations-empfindliche Hörer eine harte Prüfung. type casting gab es demnach schon lange vor der Erfindung des Fernsehens.
Szene und Musik – zufällig synchron
Film und Fernsehen haben die Ästhetik des Theaters in den vergangenen fünfzig Jahren radikal verändert. Spätestens seit den ersten Opern-Filmen ist es mit dem „Primat des Singens“ vorbei. Es reicht nicht mehr, „nur“ ein guter Sänger zu sein. Und vielleicht ist das auch gut so: Oper ist schließlich mehr als Gesang, nämlich Musik und Theater. Doch wie oft kommt beides, Musik und Theater, gleichermaßen zu seinem Recht? Wie oft erleben wir großartige Darsteller, die zugleich auch hervorragende Sänger sind, wie oft Aufführungen, die musikalisch ebenso aufregend sind wie szenisch? Und wie oft kommt es vor, dass sich Musik und Szene in ihrer Wirkung gegenseitig potenzieren? Nicht selten habe ich den Eindruck, dass es sich um zwei völlig getrennte Veranstaltungen handelt, die zufällig synchron laufen. Im Rheingold zum Beispiel gibt es eine zentrale Stelle, bei der ich immer darauf achte, ob Darstellung und vokale Aktion „kompatibel“ sind: „In der Götter neuem Glanze sonnt euch selig fortan“. Die Süffisanz und Schadenfreude, mit der Loge den Rheintöchtern begegnet, ist fast immer deutlich zu sehen – und fast nie zu hören. Zumindest für mich nicht. Andere Zuschauer haben es vielleicht wahrgenommen, mit den Augen gehört. Theater ist nicht zuletzt eine Sache der Illusion. Allerdings kann die Illusion ganz schnell schwinden, sobald man das Ganze aus der Perspektive des Kameramannes betrachtet: Das Close-Up der Kamera ist gnadenloser als der Blick des schärfsten Kritikers im Theater.
Nähe und Distanz
Elisabeth Schwarzkopf hat dieses Problem einmal mit deutlichen Worten beschrieben: „Unser Singen ist auf Distanz ausgerichtet. Deshalb ist es ja so furchtbar, wenn die Fernseh-Kamera den Sängern in den Hals kriecht. Wenn Sie die falschen Zähne und die Mandeln und die Halsentzündungen sehen, noch extra beleuchtet, dann ist das eigentlich die Vernichtung der gesamten Gesangskunst. Gesangskunst ist darauf ausgerichtet, Distanz zu überbrücken, in der größten Schönheit, Ökonomie und mit der größten Illusion. Aber die Illusuion haben Sie nicht, wenn die Kamera in den Hals fährt. Das ist dann Pornographie, meiner Meinung nach.“
Ist das der Grund, warum viele Plattensammler sich nicht damit anfreunden können, Opern auf DVD zu sehen? Sind Nahaufnahmen per se desillusionierend? Oder ist es nicht eher eine Frage des Handwerks? In seiner Verfilmung von Puccinis Tosca rückt Benoit Jacquot seinen Sängern zwar sehr nahe, zeigt aber keine Goldkronen und Zäpfchen, sondern zuckende Mundwinkel, bebende Nasenflügel und tränenverschleierte Augen. Und in besten Momenten intensivieren seine Close-Ups den Ausdruck einer Phrase, einer Szene, eines Dialogs.
Schwieriger wird es bei Aufzeichnungen im Theater: Jede Geste, die auf Distanz ausgerichtet ist, kann vor der Kamera übertrieben groß wirken. Dass man aber auch im Theater nahe herangehen kann, ohne jede Illusion zu zerstören, hat kaum einer so überzeugend gezeigt wie Brian Large: Szene und Musik fallen bei seinen Aufzeichnungen fast nie auseinander; in besten Momenten verstärken sie sich gegenseitig. Wenn es sich dann noch um eine so starke Aufführung handelt wie Lehnhoffs Makropoulos-Inszenierung mit Anja Silja, ist das Glück vollkommen.
Bei den alten Met-Inszenierungen besteht die Kunst von Large oft im Weglassen: Denn bunte Pappkulissen vor Augen zu haben wäre hier mindestens so desillusionierend wie eine Kamerafahrt in den Rachen der Sänger. Doch vielleicht ist es gerade das, was viele an Oper auf DVD stört: Dass der Blick des Zuschauers gelenkt wird; dass man nicht selbst entscheiden kann, was man sieht. Ich habe damit kein Problem, im Gegenteil: Selbst als Musikjournalist kann man nicht überall dabei sein, und so ist die DVD zumindest eine wichtige Informationsquelle. Und bei guten Regisseuren hat die Aufzeichnung einer Opern-Inszenierung auch ihre eigene ästhetische Qualität.
Besonders erfreulich finde ich den Zuwachs an Musik-Dokumentationen. Gibt es eine bessere Möglichkeit, jemanden an legendäre Dirigenten wie Toscanini, Walter, Furtwängler, Busch, Barbirolli, Reiner und Stokowski heranzuführen als die Dokumentation The Art of Conducting? In diesem Fall kann man durchaus behaupten: Wer sieht, hört mehr. Und vielleicht wird er das Hören erst durch genaues Hinsehen lernen. Fest steht jedenfalls, dass der überwiegende Teil zukünftiger Klassik-Hörer nur über das Zuschauen einen Weg zur Musik finden wird. Ist somit die Video-DVD nicht nur in technischer Hinsicht, sondern auch in pädagogischer Hinsicht ein Schritt nach vorn?
Oben war davon die Rede, dass das Ohr gerne glaubt, was das Auge sieht. Gegen diese Erfahrung ist keiner immun, sobald großartige Singschauspieler oder besonders attraktive Sänger auf der Bühne stehen: Man lässt ihnen viel eher falsche Töne oder vokale Defizite durchgehen als anderen. Den umgekehrten Fall kennen wir vom Plattenhören: Dass man vor dem inneren Auge sieht (oder sehen will) was man hört. Wenn ich in der alten Knappertsbusch-Aufnahme Karl Dönch als Beckmesser höre, habe ich die Figur in Mimik und Gestik plastisch vor Augen – und bin froh, dass es keine Dokumentar-Aufnahme gibt, die mir diese Illusion rauben könnte. Insofern war mir nicht ganz wohl, als ich das Video mit Elisabeth Grümmer als Elsa einlegte. Die Grümmer gehört zu meinen Favoriten, und bei ihren Aufnahmen habe ich immer eine Art von idealisierter Aufführung vor Augen. Aber ich wusste, dass sie zum Zeitpunkt der Fernsehaufzeichnung schon 54 war. Nun handelte es sich nicht um eine Aufführung, sondern um ein Konzert. Und da stand sie also, im schlichten schwarzen Abendkleid und sah ganz so aus, wie man sich eine würdige Kammersängerin vorstellt. Sobald sie aber die ersten Töne sang, verwandelte sie sich in die Figur – und man glaubte ihr jedes Wort. Sie klang derart jung, dass ihre eher mütterliche Erscheinung gar nicht mehr ins Bewusstsein drang. Spätestens seit diesem Erlebnis ist mir klar, dass Glaubwürdigkeit in der Oper nicht mit den Realitäts-Maßstäben von Film und Schauspiel zu messen ist: Man sieht mit den Ohren.
Musik, Sprache, Ausdruck, Klangfarben – das alles scheint letztlich eine höhere Wahrheit zu transportieren als alles Sichtbare. Dazu zum Schluß noch eine Fallstudie von Oliver Sacks: Die Ansprache des Präsidenten.
Bei der Fernseh-Übertragung der Rede eines (namentlich nicht genannten, wohl aber leicht zu identifizierenden) US-Präsidenten tönt von der Aphasie-Station schallendes Gelächter. Wer an Aphasie leidet, hat die Fähigkeit, „etwas zu verstehen und zu erkennen, was wahr und was unwahr ist, ohne die Worte zu begreifen. Folglich waren es die Mimik, die schauspielerischen Übertreibungen, die aufgesetzten Gesten und vor allem der falsche Tonfall, die falsche Satzmelodie des Redners, die diesen sprachlosen, aber ungeheuer sensiblen Patienten heuchlerisch erschien. Auf solche (für sie) höchst offenkundigen, ja grotesken Ungereimtheiten reagierten diese Patienten, die sich durch Worte nicht täuschen ließen, weil sie durch Worte nicht zu täuschen waren.“ Eine mögliche Erklärung dafür, warum sich ein Publikum als Ganzes selten täuschen lässt?
Thomas Voigt (C) 2004