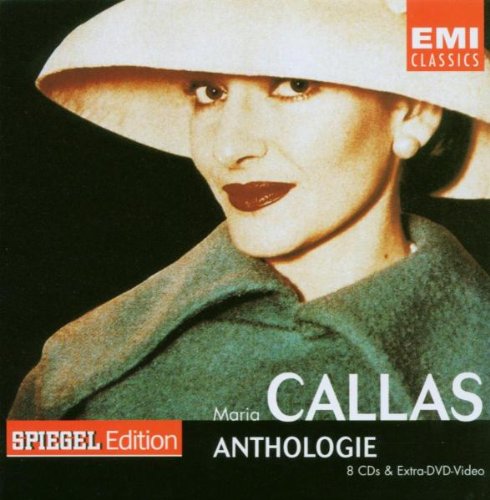Rom 1951. Walter Legge, Produzent bei Columbia (später EMI) und einer der einflussreichsten Männer im Platten-Business, hört in der Oper Bellinis Norma mit Maria Callas. Nach der Vorstellung ruft er seine Frau an, ihn sofort in einer ganz wichtigen Angelegenheit zu treffen. Doch diese lehnt ab: Sie hört gerade im Radio eine Sendung mit Arien einer gewissen Maria Callas, und keine zehn Pferde können sie vor dem Ende der Sendung wegbringen.
Sie ist selbst Sopranistin, Karajan hatte sie Legge wenige Jahre zuvor als die „vielleicht beste Sängerin in Mitteleuropa“ empfohlen; sie heißt Elisabeth Schwarzkopf.
Maria Callas ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht die primadonna assoluta. Nach ihrem Debüt in Italien, 1947 als Gioconda in der Arena di Verona, ist es mit ihrer Karriere zunächst nur mühsam vorangegangen, doch dank enormer Willenskraft, harter Arbeit und nicht zuletzt mit Hilfe des Dirigenten Tullio Serafin gehört sie inzwischen zu den begehrten Sängern der Opernszene. Mit der italienischen Plattenfirma Cetra, für die sie schon 1949 einige Arien-Titel aufgenommen hat, sind zwei Gesamtaufnahmen geplant: La Gioconda und La Traviata.
Das ist die Situation, als Legge nach der Vorstellung die Callas in ihrer Garderobe aufsucht und ihr einen Exklusivvetrag mit der Columbia anbietet. Callas und ihr Ehemann, Giovanni Battista Meneghini, sind entzückt. Doch die Verhandlungen ziehen sich mehr als ein Jahr hin. Zusammen mit Dario Soria, seinem Kompagnon in Italien, besucht Legge die Callas öfters zu Hause. „Bei jedem Treffen erwartete sie angemessenen Tribut“, schreibt der Produzent 25 Jahre später, „und schon bei der Erinnerung an die Töpfe voll blühenden Buschwerks und Bäumchen, die Dario und ich in ihr Appartement in Verona schleppten, tun mir heut noch die Arme weh.“
Doch schließlich ist es so weit: am 21. Juli 1952 unterschreibt Maria Callas den Vertrag. Die ersten Einspielungen entstehen im Januar und Februar 1953 in Florenz: Nach zwei Test-Aufnahmen von „Non mi dir“ aus Don Giovanni folgt die Gesamtaufnahme von Lucia di Lammermoor, die parallel zu Aufführungen des Werkes am Teatro Communale stattfindet. Damit beginnt eines der bedeutendsten Kapitel in der Geschichte der Schallplatte.
Allerdings legt Legge die Lucia und auch die nächsten Einspielungen – Bellinis Puritani und Mascagnis Cavalleria – vorerst auf Eis: Mit den Callas-Aufnahmen will er das neue Label „Angel“ auf dem amerikanischen Markt etablieren, und als allererste Callas-Aufnahme möchte der die Tosca unter de Sabata herausbringen: Sie ist in jeder Hinsicht so hervorragend, dass sich danach die anderen Aufnahmen von selbst verkaufen werden.
Vielleicht lässt sich anhand dieser Tosca am besten studieren, was das Besondere der Zusammenarbeit von Callas/Legge ausmacht: Beide erkannten, dass eine Studio-Aufnahme weit mehr sein kann als eine bloße Dokumentation, nämlich eine Aufführung unter bestmöglichen Bedingungen, ohne die Kompromisse des Theateralltags. Beide wußten, dass die Nähe des Mikrophons eine andere Klangästhetik zur Folge hat. Filmisch gesprochen: Dass das Close-Up im Studio eine feinere und differenzierte Gestaltung bedeutet als die „Totale“ im Theater. Ohne Übertreibung lässt sich behaupten, dass mit der Tosca eine neue Ära in der Aufnahmegeschichte begann. Noch heute, fast fünfzig Jahre nach ihrer Entstehung, ist sie einer der stärksten Beweise dafür, dass die Platte ein eigenständiges Medium ist, und nicht als „schwacher Ersatz“ für das Live-Erlebnis angesehen werden sollte.
In der Spielzeit 1953/54 hatte sich Maria Callas auf wundersame Weise verwandelt. Sie selbst hat es so notiert: Gioconda 92, Aida 87, Norma 80, Medea 78, Lucia 75, Alceste 65, Elisabetta 64. Sie war 28 Kilogramm leichter geworden – und hatte sich damit den langjährigen Wunschtraum erfüllt, so schlank zu sein wie Audrey Hepburn. Die neue Figur erschloß ihr auf der Bühne ganz neue Dimensionen, vor allem in der Darstellung jener femmes fragiles, bei denen ihre junoische Figur ein Handicap gewesen war. Doch stimmlich war es der Anfang von ihrem Ende – so behaupten zumindest viele Kollegen: Die ungeheure Energie, mit der sie in ihren frühen Jahren gesungen hat, erforderte die Kraft eines Leistungssportlers; da aber bei jeder Gewichtsabnahme nicht nur Fett, sondern auch Muskelmasse abgebaut wird, habe die schlanke Callas nicht mehr die volle Kraft gehabt, um die Stimme zu stützen. Elisabeth Schwarzkopf hat dieser Theorie vehement widersprochen: „Nicht das Abnehmen war der Grund. Sondern eine chronische Sinusitis, mit der sie jahrelang gesungen hat. Und da kompensieren die Stimmbänder für die fehlende Resonanz.“ Wie dem auch sei – anhand der vorliegenden Aufnahmen ist nicht zu überhören, dass die Callas ab 1954 Mühe hatte, ihre Stimme in den höchsten Lagen ruhig zu halten.
Evident wurde das Problem bei der Einspielung von La Forza del destino. Die Stimme der Callas begann in der Höhe zu schlingern. Im Englischen wird dieser Zustand als wobble bezeichnet. Und für Legge war ein wobble schlichtweg das rote Tuch: „Maria, wenn du weiter so singst, müssen wir jeder Plattenkassette Pillen beilegen, damit die Hörer von dem Geschaukel nicht seekrank werden!“ Wer da meint, die Diva habe daraufhin wutentbrannt den Aufnahmeraum verlassen und sei erst nach untertänigsten Kniefällen zurückgekehrt, verkennt die Arbeiterin Callas. Sie nahm sich die Kritik zu Herzen und bestand darauf, abends mit Legge und Schwarzkopf essen zu gehen. Die Szene, die sich dann im Restaurant der Mailänder Scala abspielte, hat Legge wie folgt beschrieben: „Die Callas trat ein, umarmte meine Frau und sagte, ohne sich auch nur gesetzt zu haben: ‚Zeig mir, wie du die hohen As und Bs singst und dann ein Diminuendo machst. Walter sagt, meine machen ihn seekrank.‘ Als Schwarzkopf etwas einwenden wollte, sang die Callas – alle anderen Gäste vollständig ignorierend – mit voller Stimme die Töne, wo sie Schwierigkeiten hatte, während Schwarzkopf ihr die Zwerchfellgegend. Unterkiefer, Kehle und Rippen befühlte. Die Kellner erstarrten förmlich, doch die anderen Speisenden drehten sich um, weil sie der Komödie zusehen wollten. Innerhalb weniger Minuten sang Schwarzkopf nun die fraglichen Töne, während Callas nun ihrerseits dieselben Stellen bei ihr abtastete, um herauszufinden, wie sie die Töne so ruhig halten konnte. Nach ungefähr zwanzig Minuten sagte sie: ‚Ich glaube, ich hab’s. Ich werde dich morgen anrufen, wenn ich es ausprobiert habe‘ – und setzte sich zum Essen. Tatsächlich rief sie am nächsten Tag an, um uns mitzuteilen, dass es funktionierte. Aber die Aufnahmen zeigen, dass die Kur nicht vollständig gewirkt hat.“
Dennoch – oder vielleicht auch gerade deshalb – konnte sie den Thron der primadonna assoluta einige Jahre verteidigen: Keine Sängerin des 20. Jahrhunderts hat ihre stimmlichen Defizite so grandios kompensiert wie die Callas. Abgesehen von extrem hoch notierten Partien wie der Königin der Nacht, war sie in der Lage, das gesamte Sopranfach zu singen: von der Donna Anna bis zur Isolde, von der Norma bis zur Turandot, von der Rosina bis zur Santuzza. Sie sang die Lady Macbeth mit der geforderten „Teufelsstimme“ und eine Gilda oder Butterfly mit zerbrechlichem „Kleinmädchenton“. Sie tanzte mit der Glöckchen-Arie der Lakmé wie eine Ballerina auf dem Hochteil – und hatte die Kraft für Schwerstgewichte wie Giocondas „Suicidio!“. Sie formte eine Bellini-Cantilene aus feinsten Seidenfäden und brannte fünf Minuten später ein Feuerwerk an Koloraturen ab. Dass sie auch in stimmlichen Krisenzeiten ein ungeheuer vielfältiges Repertoire beherrschte, zeigen die Aufnahmen dieser Kollektion aus den Jahren 1957/58. Hätte Walter Legge keine Callas gehabt, hätte er für das hier dokumentierte Repertoire mindestens vier Sopranistinnen mit völlig unterschiedlichen Stimmen einsetzen müssen. Ihre größte Begabung aber war ihre Musikalität, ihr Gespür für das richtige Timing, ihr Instinkt für die Architektur einer Phrase. Selbst bei Musik, die man in- und auswendig zu kennen meint, gibt die Callas dem Hörer das Gefühl, als hörte er sie zum ersten mal.
Dass die Kunst der Callas von ihrer Vita nicht zu trennen ist, zeigt die Video-Dokumentation Life and Art. Die Callas lebte zu einer Zeit, in der starke Frauen per se verdächtig waren – zumal jenen, die den starken Mann spielen wollten. Wie Rudolf Bing, der damalige Chef der Metropolitan Opera, oder Antonio Ghiringhelli, der Boss der Scala. Beide suchten das Kräftemessen mit einer Frau, die sich nicht in die Rolle der liebenswürdigen, nachgiebigen Künstlerin fügte. Für ihren Mangel an „Konzilianz“ musste die Callas teuer bezahlen: Keine Sängerin der Operngeschichte wurde von der Presse so diffamiert wie sie. Ein amerikanischer Fernsehsender schreckte sogar vor einer bewussten Falschdarstellung des Norma-Skandals in Rom nicht zurück (DVD, 38’15-39’25‘). Doch all die Lügen und Halbwahrheiten haben der Callas nichts von ihrer Größe nehmen können. Auf Platten ist sie heute präsenter als zu ihrer aktiven Zeit als Sängerin, ihre Aufnahmen sind für Hunderttausende der Türöffner zu jenem Palast der Gefühle, der sich Oper nennt. Ihr Gesang erreicht uns, berührt uns, verändert uns – heute genauso wie vor fünfzig Jahren.
Thomas Voigt (C) 2003, veröffentlicht in: